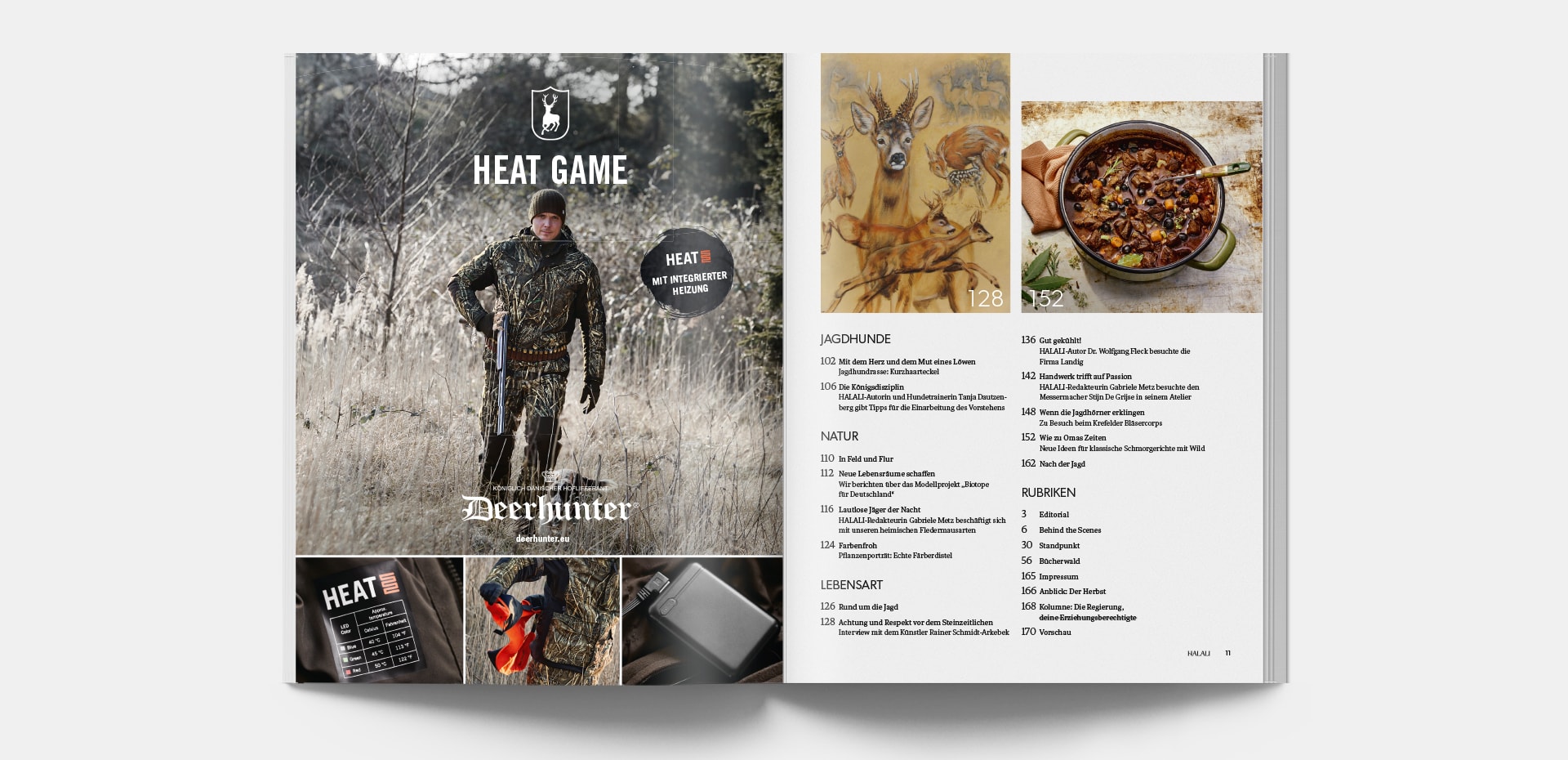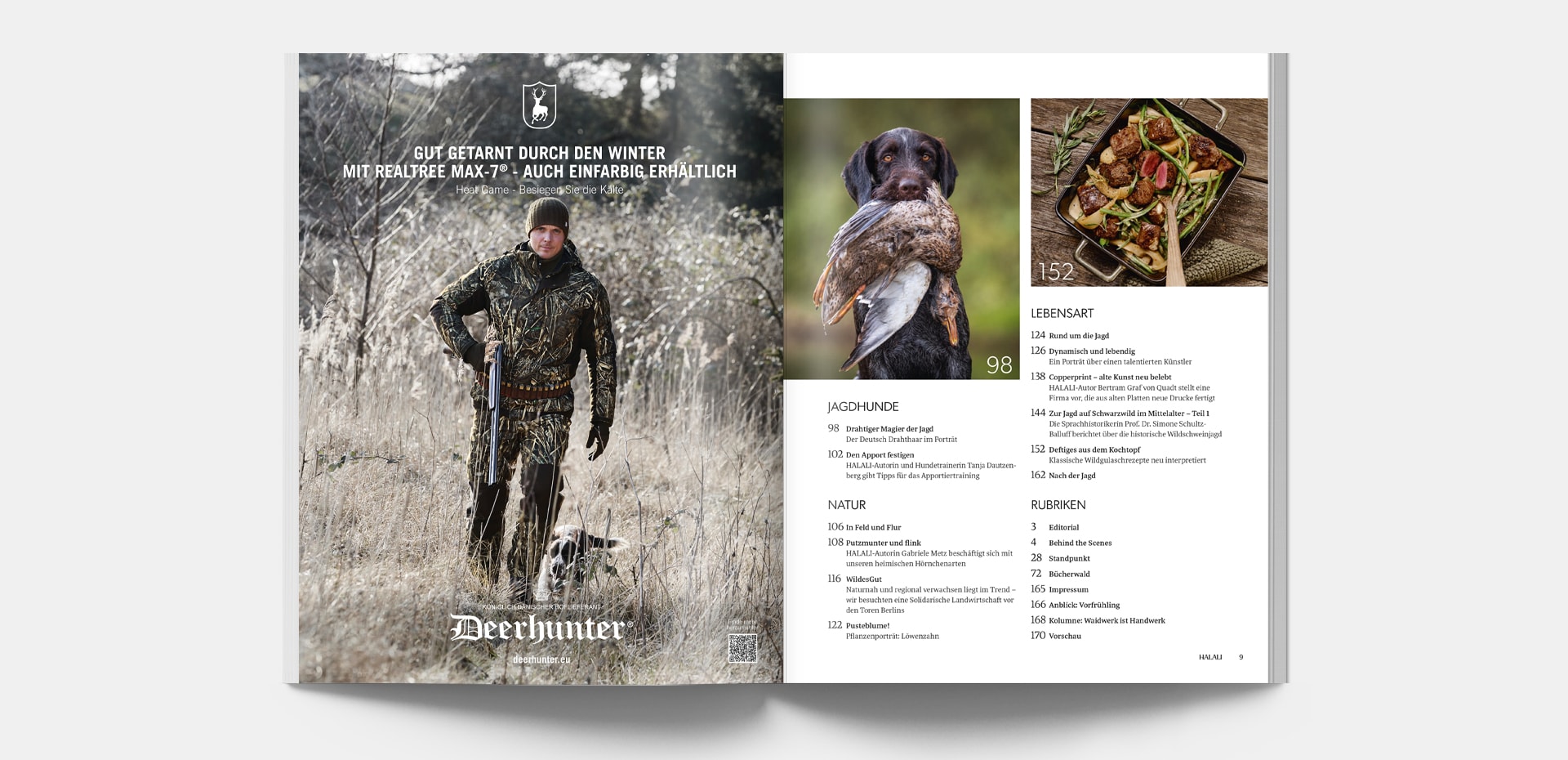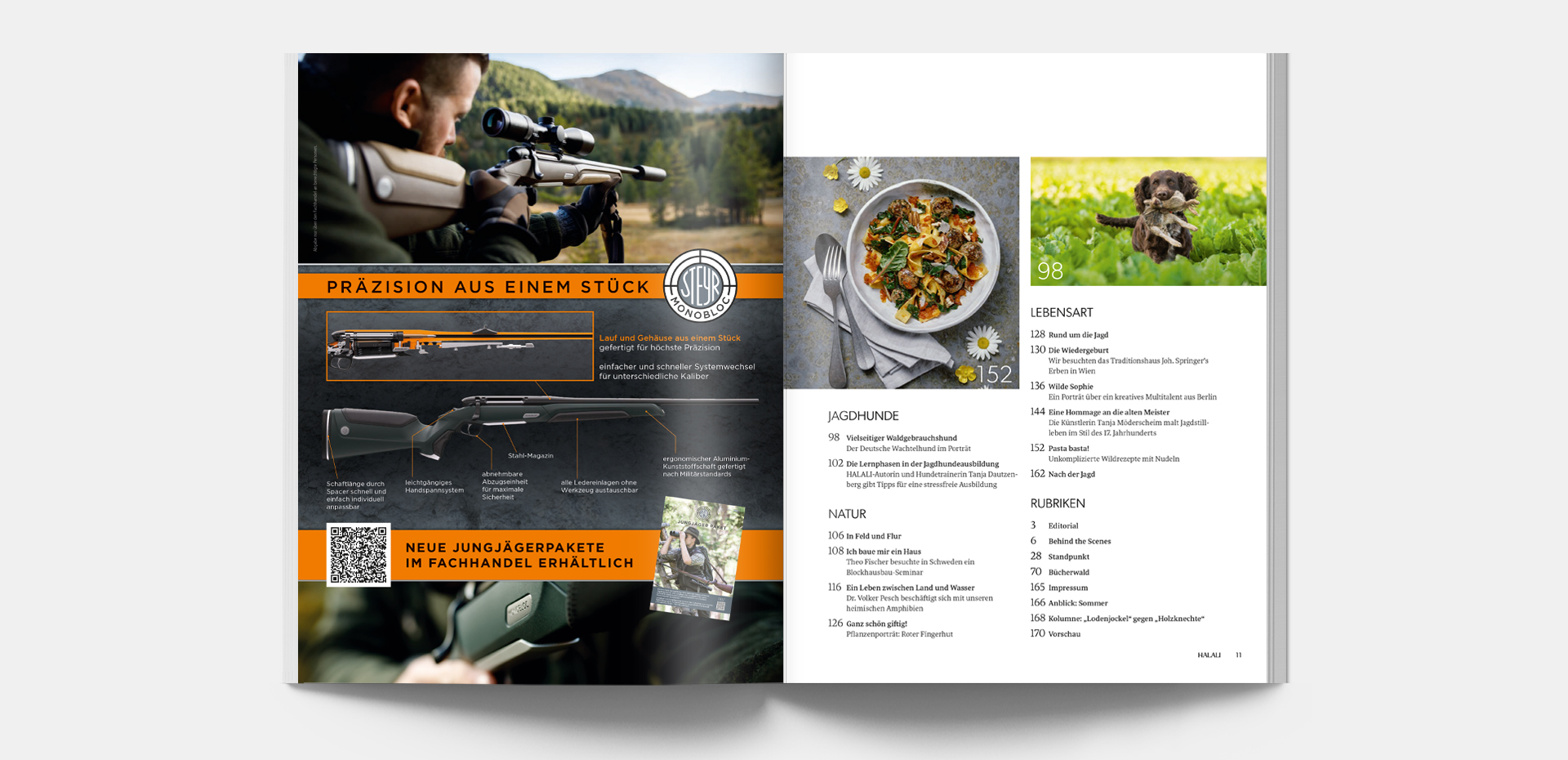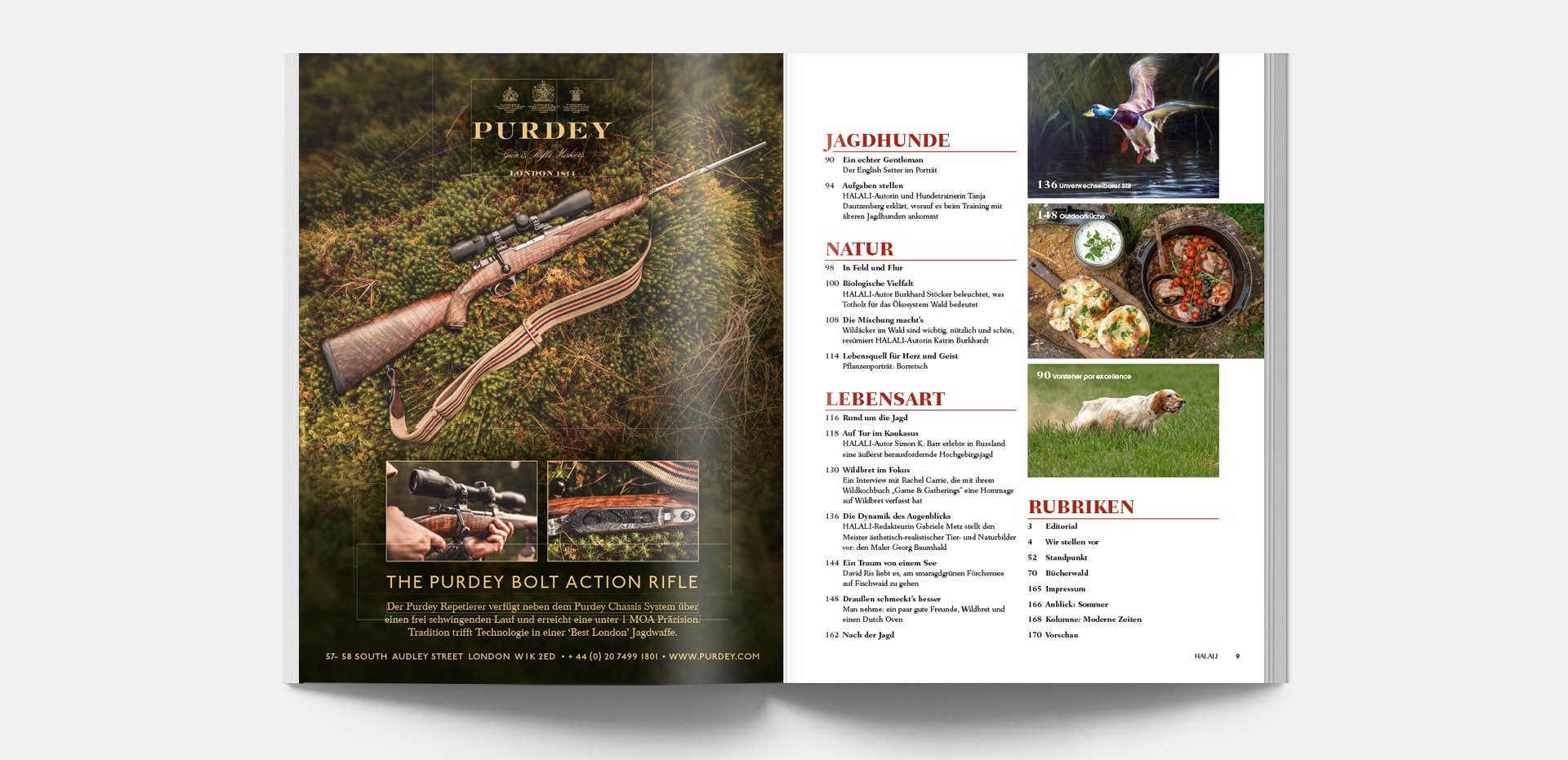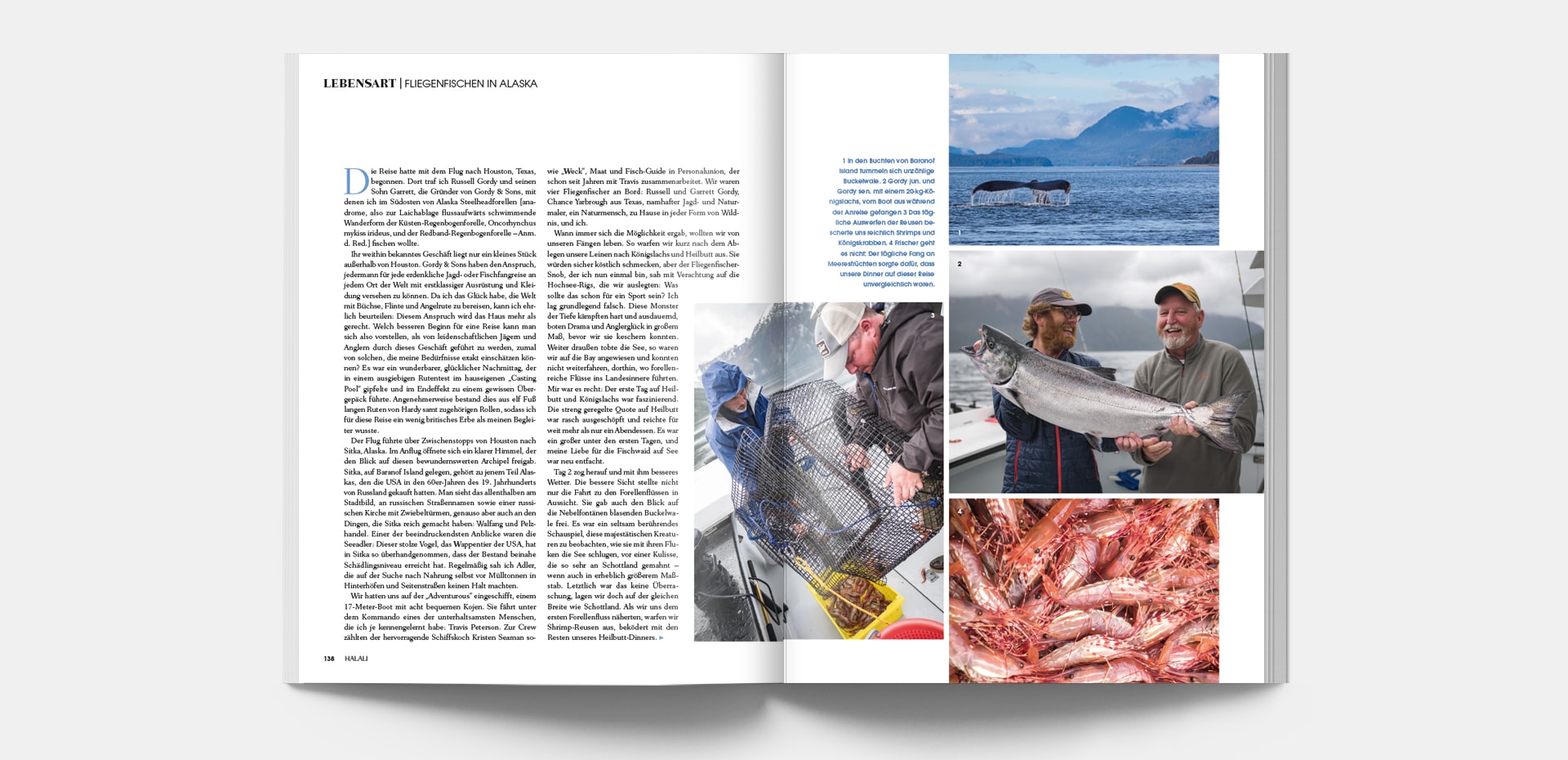„Ein unglaubliches Zeugnis“
| Text: Annette Feldmann |
Mit der Besiedlung des nordamerikanischen Kontinents wurden auch die Ureinwohner in der westlichen Kunst abgebildet. Der Maler und Indianerkenner George Catlin hielt auf seinen Reisen Jagd- und Alltagsszenen vieler indianischer Stämme fest.

„Oh, give me a home where the buffalo roam …“ lautet die erste Zeile des 1872 verfassten Songs „Home on the Range“, der aus der Feder eines gewissen Dr. Brewster M. Higley stammt. Er gilt als die inoffizielle Hymne des amerikanischen Westens (und ist de facto seit 1947 die offizielle Hymne des US-amerikanischen Bundesstaates Kansas). Kein Wunder, beschwört er doch die sagenhaften Weiten, die Natur und die Tierwelt der Great Plains – also den weithin bekannten Mythos Wilder Westen.
In Kanada und den Vereinigten Staaten gibt es, auf den gesamten nordamerikanischen Kontinent verteilt, insgesamt mehr als 1 100 Ethnien, die zu den First Nations (Kanada) bzw. Native Americans (USA) zählen. Wenn wir in Deutschland „Indianer“ sagen, gilt unser erster Gedanke jedoch meist den Stämmen, die in eben jenem Westen auf Büffeljagd gingen, oder den „Indianern“, die uns zunächst in Karl-May-Büchern und -Filmen begegneten.
Zu den Plains- oder Prärie-Indianern zählen z. B. die Lakota, Blackfoot, Apache, Sioux oder Pawnee. Sie lebten als Halbnomaden vom Ackerbau und von der Jagd. Neben Elch und Antilope war es vor allem der Amerikanische Bison (Bos bison), meist als Büffel (engl. „buffalo“) bezeichnet, den sie mit Speeren, Pfeil und Bogen oder knüppelartigen Waffen bejagten. Bevor die europäischen Siedler den nordamerikanischen Kontinent besetzten, gab es dort schätzungsweise 30 Millionen Bisons. Ihre Zahl verringerte sich drastisch – fast bis hin zur Ausrottung gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Sie fielen einem regelrechten Jagdrausch der Siedler zum Opfer, und dank Eisenbahn und Gewehren töteten diese problemlos mehrere Dutzend Tiere pro Tag.
Ohne Lebensgrundlage
„Wäre ein Plains-Indianer im Jahr 1869 […] in Tiefschlaf gefallen und erst zwei Jahrzehnte später wieder aufgewacht, hätte er die ihm einst so vertraute Welt nicht mehr erkannt. Wo zuvor Bisons, Gabelböcke und Wildpferde herumgeschweift waren, weideten nun auf mit Stacheldraht umzäunten Wei-den Rinder-, Schweine- und Schafherden“, schreibt der Schweizer Historiker Aram Mattioli in seinem Buch „Verlorene Welten“. Doch nicht nur die Zahl der Büffel wurde kleiner. Die europäischen Siedler verdrängten die Ureinwohner aus ihrem Lebensraum in Reservate, sie steckten sie mit Krankheiten an, gegen die sie nicht immun waren, sodass sie daran starben, oder sie erschossen sie direkt.
Viele Natives verhungerten auch einfach, weil die Siedler ihnen ihre Lebensgrundlage raubten. Und diese bestand für die Plains-Indianer in den Büffeln. Sie verwerteten sämtliche Bestandteile der Tiere, das Fleisch als Nahrung, aus Knochen stellten sie Werkzeug, Schmuck und Gebrauchsgegenstände her, Sehnen und Felle nutzten sie für Kleidung und Tipis.
Neben den oben bereits genannten Jagdwaffen wendeten die Indianer zudem den sogenannten „Buffalo Jump“ an, um Bisons zu erlegen. Dafür verkleidete sich ein schneller junger Mann mit einem Fell und Hörnern als Büffel und schlich sich an eine Herde heran, die sich in der Nähe eines Felsabgrunds aufhielt. Von der anderen Seite kommend, kreisten weitere Jäger die Tiere ein, die daraufhin erschreckt und in Panik flüchteten. Der verkleidete Indianer lockte die Büffel an den Abgrund, an dem sie nicht mehr stoppen konnten und in den Tod stürzten.


Darstellung in der Kunst
Das Leben der Ureinwohner und ihre Verbundenheit mit der Natur, ihre Art, zu jagen – all das wurde auch in der westlichen Kunst zum Motiv und Thema. Im frühen 19. Jahrhundert seien Ureinwohner als Wilde dargestellt worden, schreiben Elizabeth Mankin Kornhauser, Amy Ellis und Maureen Miesmer in „Hudson River School: Masterworks from the Wadsworth Atheneum Museum of Art“ (2003, Yale University Press). Sie führen als ein Beispiel das Bild „The Murder of Jane McCrea“ von John Vanderly (1804) an. Eine andere (und seit Langem überholte) Sicht- und Darstellungsweise war die des Noble Savage, des edlen Wilden, der jenseits der weißen Siedlungen im Westen lebte. Geprägt wurde diese Vorstellung unter anderem durch den französisch-schweizerischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau, von dem der Satz „Der Mensch ist von Natur aus gut“ (1755) stammt. Ohne Bezug zur weißen Zivilisation sei der Wilde ein unverdorbener, ursprünglicher Natur-mensch, der keine Gewalt kenne und friedlich, naturnah und sexuell freizügig lebe.