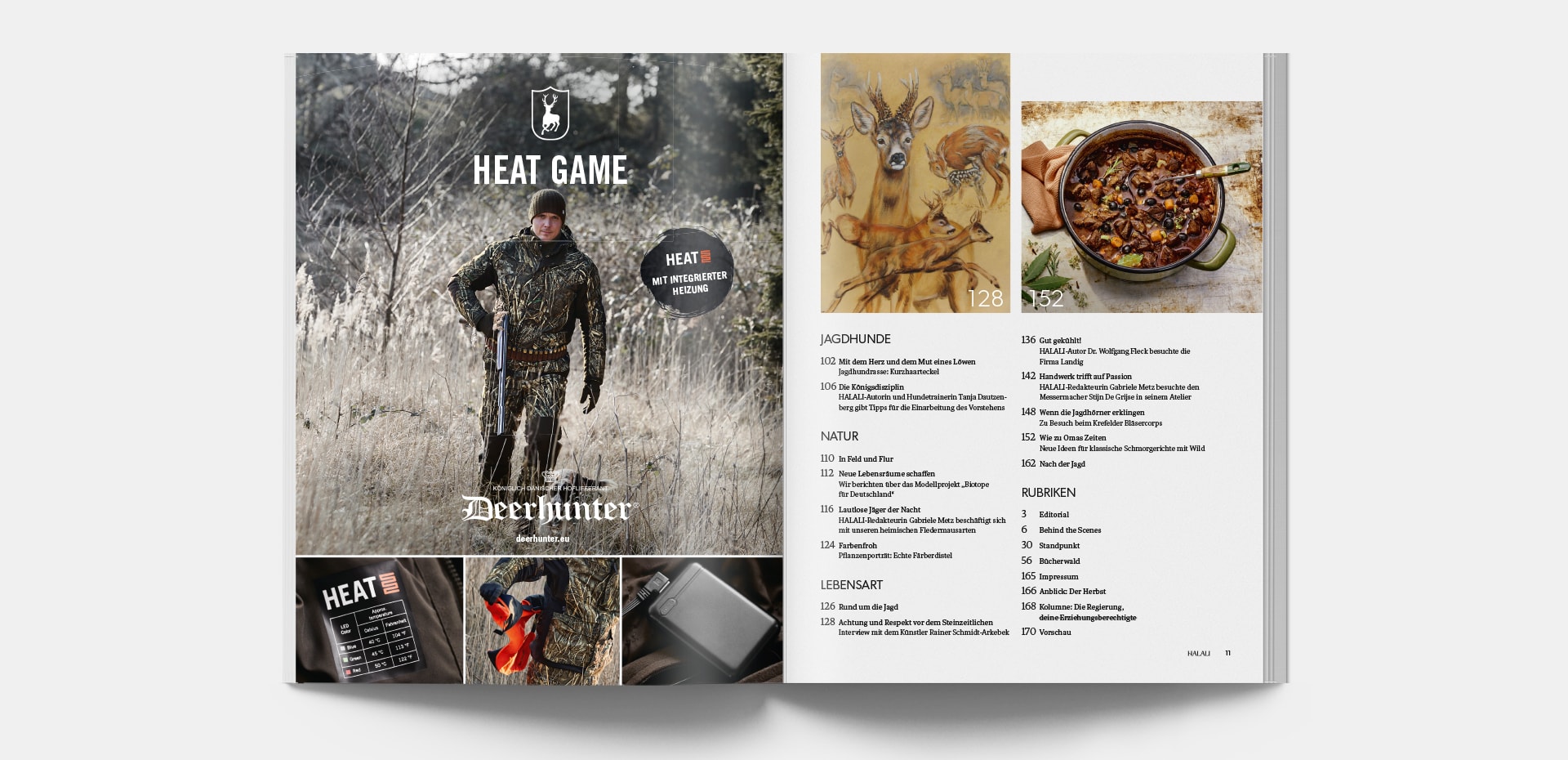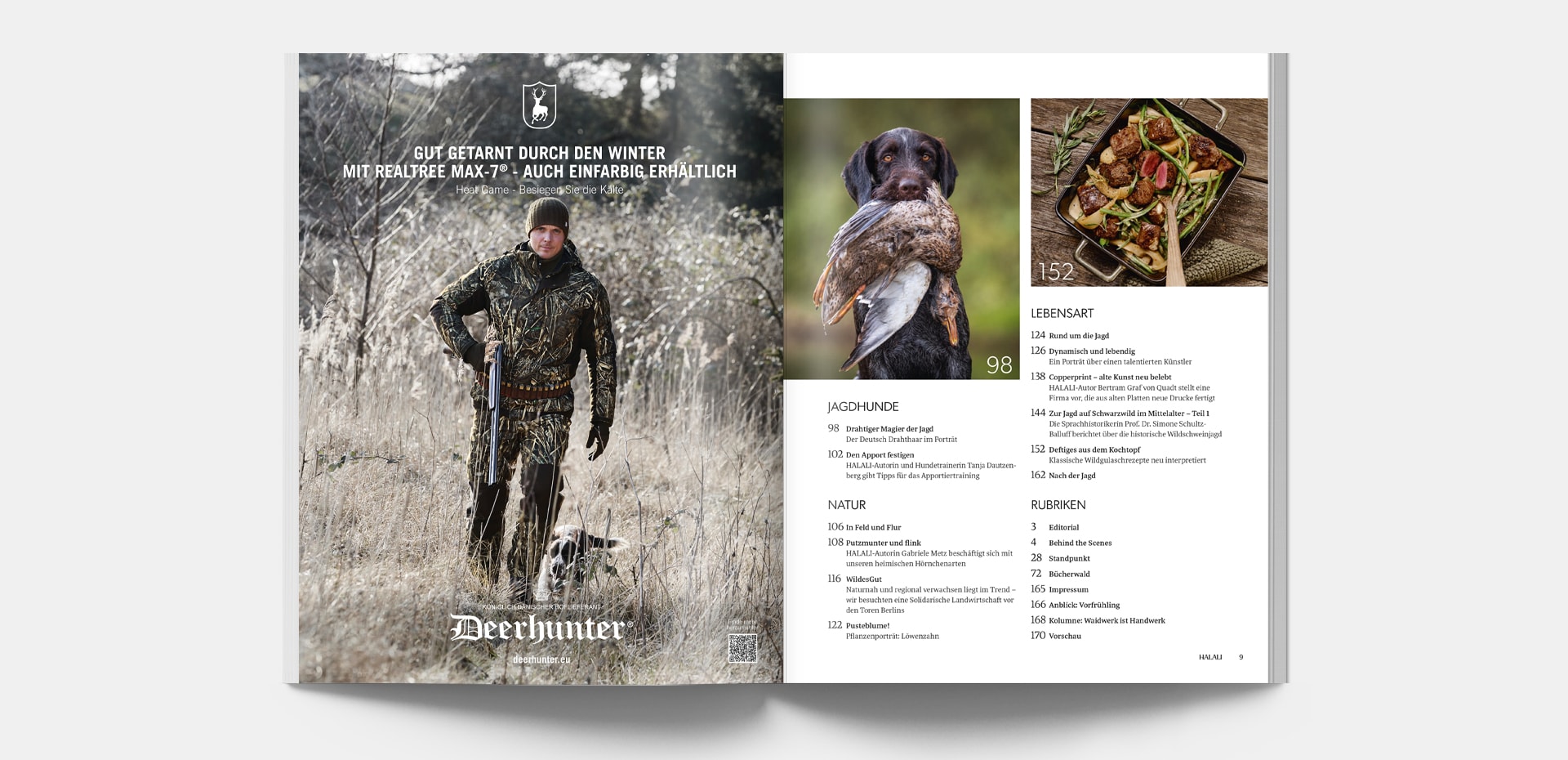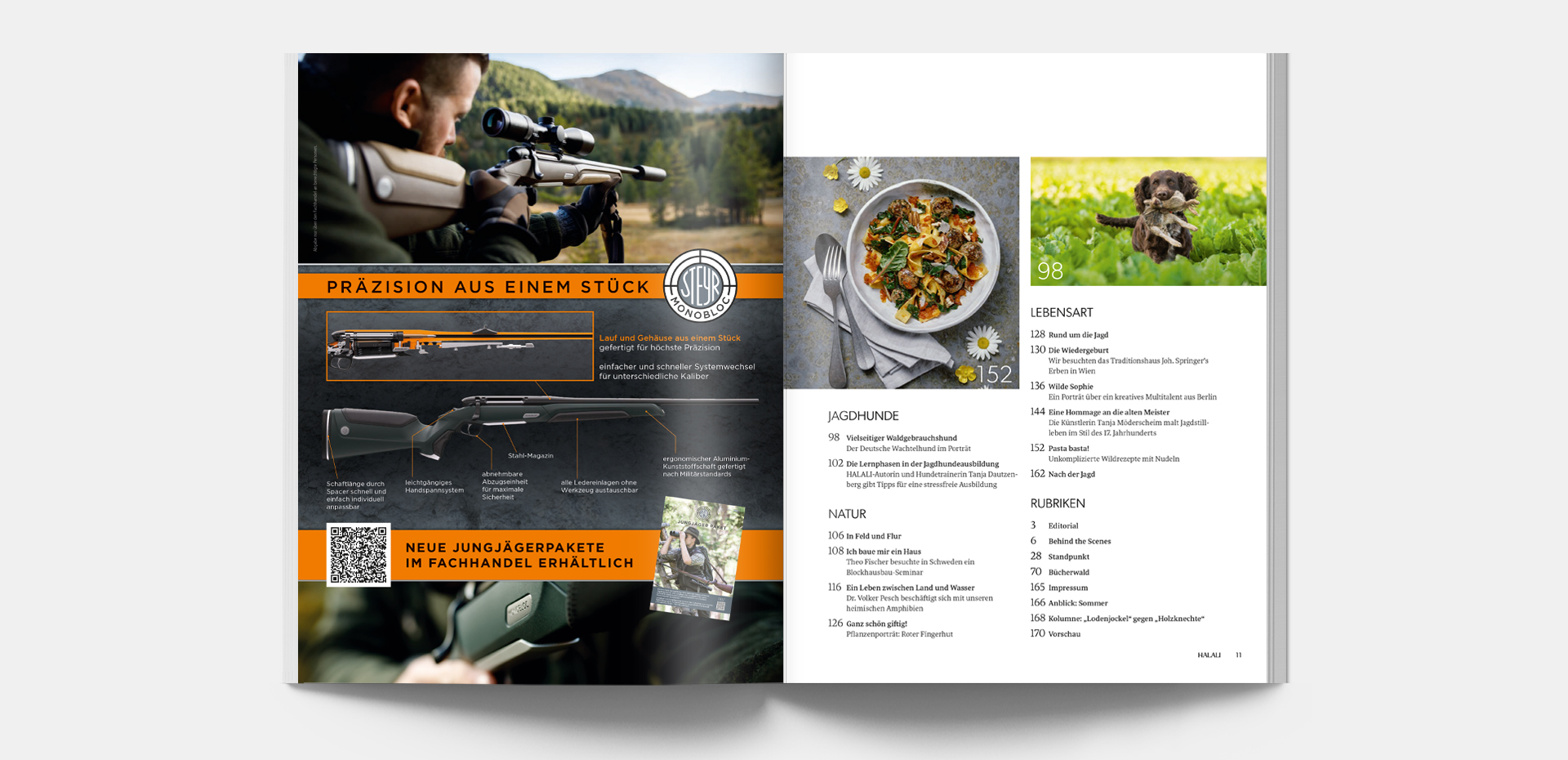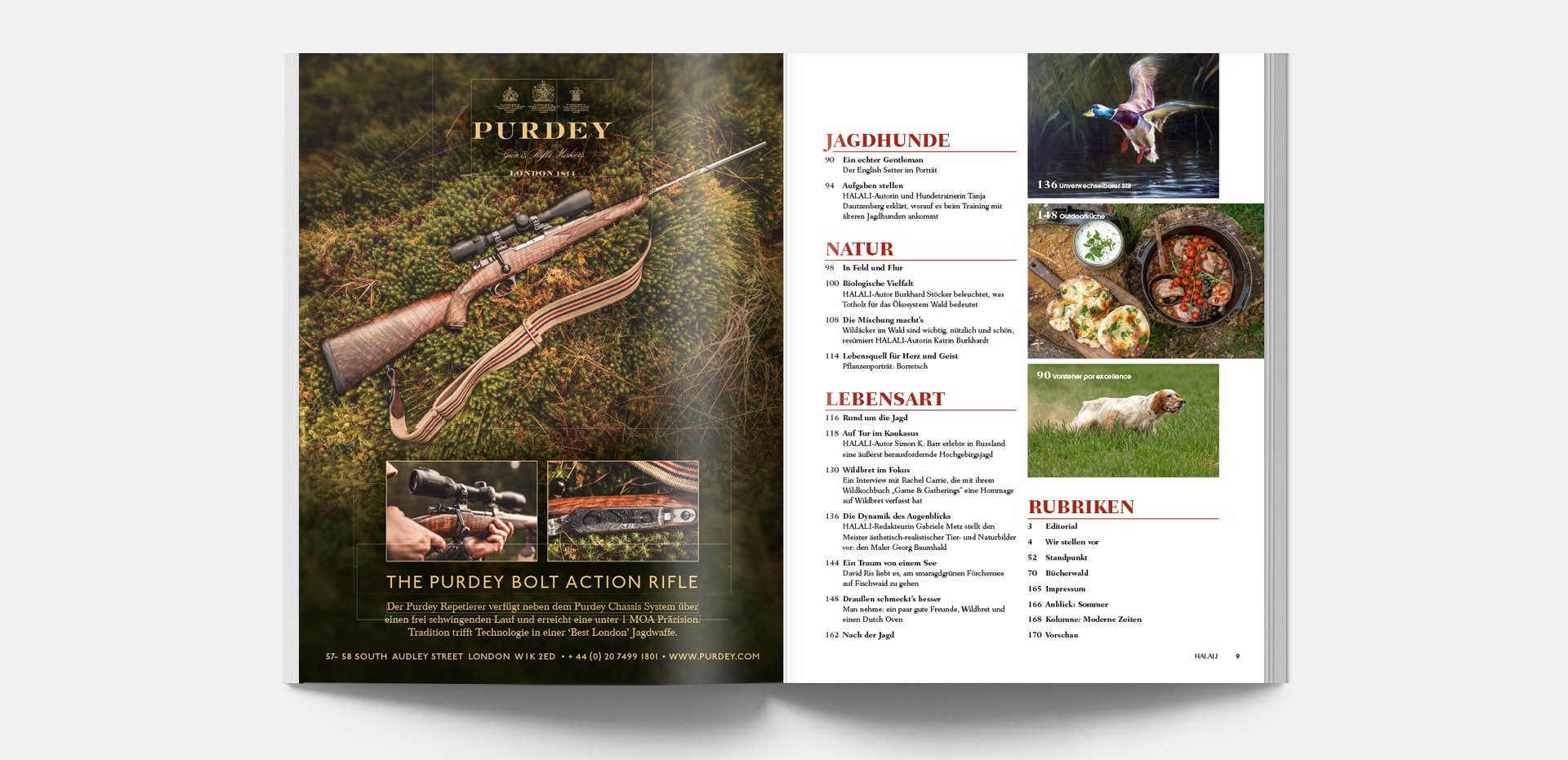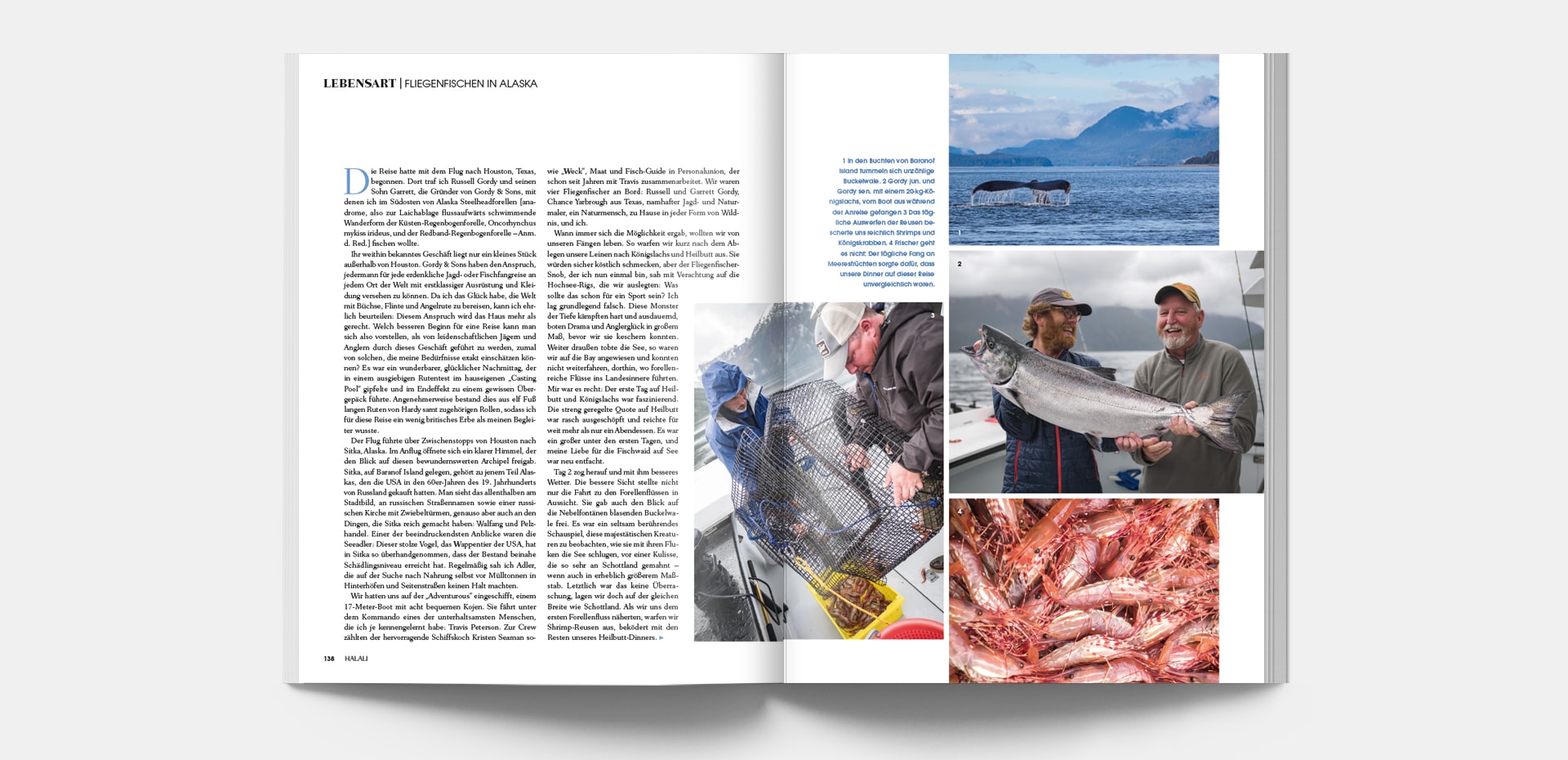Totholz – doch voller Leben
| Text: Burkhard Stöcker |
„Totholz sollte im Wald verbleiben – auch wenn der Rehbock nicht in hohlen Bäumen nistet“, so der ehemalige Baden-Württembergische Forstmeister Albrecht-Wilhelm Crocoll. Er brachte damit schon vor vielen Jahrzehnten auf den Punkt, dass wir Jäger unseren Horizont deutlich weiter ziehen müssen als nur mit Fokus auf das Wild.

Wenn wir Wild verstehen wollen, müssen wir die Ökosysteme, in denen unser Wild lebt, verstehen. Erst dann werden wir auch dem Wild, das in und mit ihnen lebt, gerecht werden können. Und „auch wenn der Rehbock [bis heute – Anm. d. Verf.] nicht in hohlen Bäumen nistet“, so hat doch totes Holz für Waldökosysteme eine immense Bedeutung. Zahllose Arten profitieren davon – auch zahlreiche jagdlich interessante sind darunter.
Totholz für Specht, Rotkehlchen und Co.
Die charakteristischen „Vögel des toten Holzes“ sind in unseren Breiten unzweifelhaft die Spechte. Nicht umsonst nennt man sie auch die „Zimmerleute des Waldes“. Alle Spechtarten haben als Höhlenbauer und Insektenfresser in Urwäldern meist höhere Dichten als im Wirtschaftswald. Im ostpolnischen Urwald von Białowieza ist beispielsweise die Siedlungsdichte des Mittelspechtes dreimal so hoch wie im angrenzenden Wirtschaftswald, die Dichte des Kleinspechtes viermal und die des in besonderem Maße auf Totholz spezialisierten Dreizehenspechtes siebenmal so hoch.
Mit zunehmender Artenzahl und Anzahl der Spechte steigt natürlich auch das Höhlenangebot für andere Vogelarten. Dies scheint im Urwald von Białowieza sogar so weit zu gehen, dass Arten, die in anderen Regionen Europas offene Nester bauen, dort zu Höhlenbrütern werden – Angebot schafft hier offenbar Nachfrage. Dies trifft im Urwald von Białowieza auf für uns so bekannte Arten wie die Amsel, das Rotkehlchen oder die Heckenbraunelle zu. Möglicherweise waren diese Arten früher einmal reine Höhlenbewohner und haben sich erst mit dem abnehmenden Höhlenangebot in den Wirtschaftswäldern auf offene Nester umgestellt.
Die Anzahl der Vogelarten, die selbst in der Lage sind, Höhlen zu zimmern, ist in Europa gering. Ne-ben allen bei uns heimischen Spechtarten sind es außerdem nur der Kleiber und die kleine Weidenmeise. Die Anzahl der Arten jedoch, die in Höhlen brüten, ist ungleich höher. Nur selten entstehen komfortable Höhlen ohne die zusätzliche Arbeit der höhlenbauenden Arten, etwa durch Astabbrüche oder Pilzbefall. Meist sind es erst Spechte, Kleiber und die unscheinbare Weidenmeise, die die Höhlen zimmern, die nachfolgend auch von anderen Arten genutzt werden, wobei die Höhlen der kleinen Weidenmeise natürlich nur für ähnlich große Vögel infrage kommen.
Die großen Schwarzspechthöhlen werden in Gewässer nähe oft vom Gänsesäger oder von der Schellente genutzt, in tiefen Wäldern auch häufig von der Hohltaube. Interessanterweise werden Baumhöhlen in stehenden toten Bäumen gegenüber Höhlen in lebenden Bäumen von zahlreichen Arten bevorzugt als Nist- und Wohnhöhlen gewählt. Angefaulte Bäume oder Baumstümpfe können oft kaum das Gewicht eines potenziellen Räubers tragen. Ein astloser und/oder rindenloser Stamm bietet für Räuber kaum Klettergelegenheit, um an die hoch gelegenen Höhlen zu kommen.


Auerwild und Totholz
Zahlreiche Totholzkomponenten des Urwaldes gehören zu den wesentlichen Requisiten eines günstigen Auerhuhnlebensraumes: Umgestürzte Wurzelteller können als Balzplatz, Huderpfanne oder auch zur Aufnahme von Magensteinen genutzt werden. Vor allem für die zur Zerkleinerung der Nahrung im Magen so wichtigen Magensteinchen scheinen Wurzelteller im Flachland eine wichtige Bedeutung zu haben.
Während im Bergland die Zugänglichkeit von Magensteine durch die oft nur geringmächtigen Boden-auflagen oder auch offen zutage tretendes Gestein gegeben ist, scheint dies im Tiefland begrenzt zu sein. Umgekippte Wurzelteller bringen hier steiniges Material an die Oberfläche und machen es so fürs Auerwild erst zugänglich. Ameisen spielen für die Ernährung der Jungvögel eine überragende Rolle. Zahlreiche Ameisenarten profitieren von Totholz – die Urwaldkomponente totes Holz dient da-her auch einer erfolgreichen Reproduktion des Auerwildes.
Herbivoren und Totholz
Hat Totholz auch Bedeutung für große Pflanzenfresser? Vordergründig offenbar erst einmal nicht – Hirsche und Rehe fressen kein totes Holz. ,„Bohrt“ man allerdings beim Thema Totholz etwas tiefer, wird man schnell fündig. Vom Wisent ist bekannt, dass er etliche Totholz bewohnende Pilzarten aus-gesprochen gerne verspeist. Auch vom Schwarzwild wissen wir aus etlichen Mageninhaltsanalysen, dass verschiedene Pilzarten zum Nahrungsspektrum gehören. Auch Hirsche und Rehe verschmähen Pilze keinesfalls, so etwa den Hirschtrüffel, der für Menschen ungenießbar ist, jedoch vom Wild gerne angenommen wird.
Über die Aufnahme von Totholz bewohnenden Pilzen durch heimisches Wild ist vermutlich aber auch deswegen so wenig bekannt, weil es kaum nennenswerte Mengen und Artenzahlen von Totholz be-wohnenden Pilzen in den heimischen Wäldern gibt. Im Urwald von Białowieza, in dem etliche Hundert Pilzarten allein auf Totholz leben, spielen diese Pilze im Nahrungsspektrum der Großherbivoren sicherlich eine andere Rolle als im fast „totholzpilzfreien“ Wirtschaftswald.
Meine einzige persönliche „Totholzpilzbeobachtung“ mit Großsäugern aus heimischen Wäldern liegt gar nicht so lange zurück. In einem norddeutschen Mittelgebirge bewindete in einem totholzreichen Buchenaltholz ein junger Hirsch interessiert Zunderschwämme (Fomes fomentarius) – sie wuchsen dort zahlreich an liegenden und stehenden Stämmen von Buchen. Die Fruchtkörper waren jedoch so alt und verholzt, dass der Hirsch wohl kaum an eine kulinarische Verwendung gedacht haben mag.
Und nicht nur als Pilzmedium ist Totholz für Pflanzenfresser interessant. Mit zunehmender Zersetzung beginnen immer mehr Kräuter die zerfallenden Baumleichen zu besiedeln. Zahlreiche Arten sind darunter, von denen zum Beispiel die Himbeere oder auch die Brennnessel attraktive Nahrungspflanzen sind. Hat sich der Baum dann völlig zersetzt, hat der Boden dort oft über Jahrzehnte einen enor-men Nährstoffinput erhalten. Die Wachstumsbedingungen sind somit dort auch für zahlreiche Nahrungspflanzen des Wildes sicherlich günstiger als anderswo.